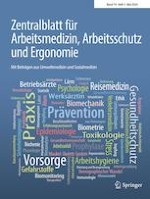Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) bietet, neben der Entsorgung des klassischen Hausmülls (bestehend aus Verpackungen und Wertstoffen, Bioabfall, Papier und Restmüll), die Abholung von sogenanntem Sperrmüll an. Dabei handelt es sich um sperrige Gegenstände wie Schränke, Polstermöbel, Tische, Matratzen, Bettgestelle, Teppiche, Fußbodenbeläge, Waschmaschinen, Trockner, Gefrier- und Kühlgeräte, Gartenmöbel, Herde, Fahrräder und Fernsehgeräte. Die unterschiedlichsten Gegenstände werden aus privaten Haushalten bzw. gewerblichen Standorten abgeholt. Die Entsorger
1 leisten dabei stets manuelle Arbeit (Heben, Halten, Tragen), wobei sie häufig Treppen steigen müssen (zur Wohnung, in den Keller) und unterschiedlich lange Strecken zwischen Abholort und Abholfahrzeug zu Fuß zurücklegen müssen. Die Sperrmüllabholung erfolgt in Vierer- bzw. Fünfer-Teams mit zwei LKW: ein Möbelwagen und ein Presswagen. Die Fahrer sind genauso an der Entsorgungsarbeit beteiligt wie die anderen Mitglieder der Kolonne.
Manuelle Tätigkeiten, insbesondere wenn sie mit der Handhabung von schweren Lasten verbunden sind oder in ungünstigen Positionen erfolgen, stellen ein Risiko für die Entwicklung von muskuloskeletalen Beschwerden und objektivierbaren muskuloskeletalen Schädigungen dar [
3,
14]. Muskuloskeletale Schmerzen haben in Deutschland eine hohe Prävalenz, wie verschiedene repräsentative Erhebungen zeigen [
6,
19,
25,
28]. Unabhängig von ihrer Lokalisation, gehen muskuloskeletale Probleme mit einer reduzierten Arbeitsfähigkeit einher [
2]. In Deutschland stellen muskuloskeletale Probleme die erste Ursache für Arbeitsunfähigkeit dar [
13]. So weisen in Deutschland Beschäftigte in der Abfallentsorgung hohe Fehlzeiten und einen hohen Krankenstand auf, wobei muskuloskeletale Erkrankungen nach wie vor wesentlich zu den erhöhten Fehlzeiten beitragen [
15,
16].
Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Prävalenz von muskuloskeletalen Beschwerden unter den Beschäftigten der Sperrmüllabholung zu erheben und die möglichen Zusammenhänge mit der Lebensqualität der Beschäftigten zu untersuchen.
Methodik
Studiendesign
Wir führten eine anonyme Befragung zwischen Juni und Oktober 2018 im Sinne einer Querschnittstudie unter der Belegschaft der Abteilung für Sperrmüllentsorgung der SRH durch. Die Befragung erfolgte im Rahmen eines von der SRH finanzierten umfassenden interdisziplinären Projekts, welches auch Feldbeobachtungen, arbeitsphysiologische Untersuchungen und Interviews umfasste [
22].
Zielgruppe der Erhebung waren alle gewerblichen Entsorger (d. h. Entsorger und Fahrer, da Letztere zu gleichem Maße an der Entsorgung beim Kunden teilnehmen) des Bereiches Sperrmüll (n = 105, in 2018). Die Teilnahme war freiwillig und anonym. Ein positives Votum der Ethikkomission der Ärztekammer Hamburg hat vorgelegen (PV5715).
Fragebogen
Die Papier-Fragebögen wurden an die Entsorger zusammen mit einer Information zum Zweck und Inhalt der Studie sowie einem frankierten Rückumschlag von der Personalabteilung in ihr persönliches Postfach verteilt. Die Fragebögen wurden von den Mitarbeitern selbst direkt an das ZfAM zurückgeschickt. Die Fragebögen waren in deutscher Sprache.
Der Fragebogen umfasste 8 Seiten mit Deckblatt und Ausfüllhinweisen und enthielt Fragen zu soziodemografischen Variablen, arbeitsbezogenen Belastungsfaktoren, Beschwerden des Muskel-Skelett-Systems und zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Für die Erfassung der verschiedenen Aspekte wählten wir validierte und etablierte Instrumente aus, die Vergleiche mit der Allgemeinbevölkerung ermöglichen.
Das Ausfüllen des Fragebogens war in 10 bis 15 min möglich.
Außerdem wurden die Skalen „Quantitative Anforderungen“ und „Emotionale Anforderungen“ des COPSOQ (
Copenhagen Psychosocial Questionnaire) verkürzte Version vom 2005 [
20] abgefragt. Der COPSOQ ist ein branchen- und berufsübergreifender Fragebogen zur standardisierten Erfassung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, der ins Deutsche übersetzt und validiert wurde [
20]. Die COPSOQ-Skalen „Quantitative Anforderungen“ und „Emotionale Anforderungen“ bestehen aus 4 bzw. 3 Fragen mit Antwortmöglichkeiten in einer 5‑stufigen Skala (0 = „nie/fast nie“ bzw. „in sehr geringem Maß“ bis 100 = „immer“ bzw. „in sehr hohem Maß“). Die Werte jeder Skala werden als einfacher Mittelwert der Werte der Einzelfragen berechnet. Der Skalenwert der beiden Skalen „Quantitative Anforderungen“ und „Emotionale Anforderungen“ kann Werte zwischen 0 (niedrigste Belastung) und 100 (maximale Belastung) einnehmen.
Das Vorliegen von Rückenbeschwerden wurde in Anlehnung an den telefonischen Gesundheitssurvey 2003 vom RKI mit 5 Fragen zum Auftreten von Rückenschmerzen, einschließlich chronischer (≥ 3 Monate lang) Rückenschmerzen während der letzten 12 Monate erfragt [
19]. Das Vorliegen von anderen Muskel-Skelett-Beschwerden wurde in Anlehnung an die DEGS (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland) des RKI erhoben [
6]. Darüber hinaus wurden eigene Fragen zur Arbeitsunfähigkeit („An wie vielen Tagen waren Sie aufgrund von Rückenschmerzen in den vergangenen 12 Monaten durch einen Arzt arbeitsunfähig bzw. krank geschrieben?“) und Behandlung („Waren Sie aufgrund von Rückenschmerzen in den vergangenen 12 Monaten in Behandlung, z. B. ärztlich, krankengymnastisch?“) im Zusammenhang mit Rückenschmerzen oder anderen Muskel-Skelett-Beschwerden. Zudem wurde der Arbeitsplatzbezug erfragt „Wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten Rückenschmerzen hatten, wann traten diese am ehesten auf, an Arbeitstagen oder an arbeitsfreien Tagen (Wochenende, Urlaub)?“ mit folgenden Antwortmöglichkeiten: „Ausschließlich/fast ausschließlich an Arbeitstagen – überwiegend an Arbeitstagen – gleich an Arbeitstagen und an freien Tagen – überwiegend an freien Tagen – ausschließlich/fast ausschließlich an freien Tagen“.
Außerdem wurde die globale Lebensqualität mit der deutschen Version des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten und validierten WHOQOL-Bref-Instruments erhoben [
1]. Dabei wird die Selbsteinschätzung der Lebensqualität und der Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit in den vergangenen 2 Wochen in einer 5‑stufigen Skala von „sehr schlecht“ bzw. „sehr unzufrieden“ bis „sehr gut“ bzw. „sehr zufrieden“ erfragt. Neben der Einschätzung der globalen Lebensqualität wurde auch die Domäne der physischen Lebensqualität, die aus 7 Fragen mit 5‑stufigen Antwortmöglichkeiten besteht, abgefragt. Aus den Antworten wird ein Score der physischen Lebensqualität berechnet, der Werte zwischen 0 und 100 einnehmen kann, wobei ein höherer Score eine höhere Lebensqualität widerspiegelt.
Die Daten wurden mit der Software IBM SPSS Statistics V.23.0 (IBM, Armonk, NY, USA) und Epi InfoTM V 7.2 (Centers for Disease Control, Atlanta, GA, USA) analysiert. Abbildungen wurden mit SPSS und MS-Excel (Microsoft, Redmond, WA, USA) generiert. Die deskriptiven Statistiken werden als Häufigkeiten und Prozente für kategoriale Variablen und als Mittelwerte mit Standardabweichung und Median für kontinuierliche Variablen angegeben. Die Mittelwerte der Lebensqualitätscores der Beschäftigten mit und ohne Rückenbeschwerden wurden in bivariaten Analysen mittels t‑Test für unabhängige Stichproben verglichen. Es wurde zudem eine multiple lineare Regression mit der Lebensqualität als abhängige Variable und dem Alter und der Prävalenz von Rückenbeschwerden als unabhängige Variablen durchgeführt. Die Voraussetzungen für die lineare Regression wurden geprüft. Wir berichten die Regressionskoeffizienten und die angepassten Nagelkerke’s R2 der jeweiligen Modelle. In bivariaten Analysen mittels Kreuztabellen und Chi-Quadrat-Test wurde der Zusammenhang zwischen Prävalenz von Rückenbeschwerden und dem EQ-5D-Status untersucht.
Es wurden zweiseitige p-Werte berechnet. Das statistische Signifikanzniveau wurde auf p < 0,05 festgelegt. Die p-Werte wurden mittels Bonferroni-Holm-Prozedur für multiples Testen korrigiert. Es wurden 95 % Konfidenzintervalle berechnet.
Diskussion
Neben der Abholung des klassischen Hausmülls und Biomülls in standardisierten Containern und der manuellen Straßenreinigung, die jeweils mit einer starken kardiovaskulären Beanspruchung einhergehen [
23], stellt die Entsorgung von Sperrmüll ein weiteres Tätigkeitsfeld in der Abfallwirtschaft dar, das starke muskuloskeletale Belastungen mit Besonderheiten aufweist. Der Hauptunterschied zu den recht gut quantifizierbaren Belastungen der Müllentsorgung mit Containern ist der Umgang mit Sperrmüll-Lasten unterschiedlicher Größe, Gewicht und Handhabbarkeit, die nicht in standardisierten Behältern gesammelt werden können. Nach unserer Kenntnis liegen bisher keine Studien vor, die die Belastungen und Beanspruchungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Sperrmüllentsorgung untersucht haben.
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die Tätigkeit der Sperrmüllabfuhr – die in unserer Untersuchung nur von männlichen Beschäftigten durchgeführt wird – aus ergonomischer Sicht besonders belastend ist. Hingegen beinhaltet, nach EWCS, die berufliche Tätigkeit von 44 % der männlichen Beschäftigten in Deutschland fast nie oder nie die Handhabung schwerer Lasten. Auch liegen bei 32 % fast nie oder nie schmerzhafte bzw. ermüdende Körperhaltungen vor, und 25 % der Beschäftigten sind fast nie oder nie durch die Durchführung repetitiver Hand-Arm-Bewegungen belastet [
5]. Dagegen ist die Tätigkeit der Sperrmüllentsorger deutlich belastender. Sie sind zu 75 % Beschäftigte, die oft bis immer schwere Lasten tragen müssen, 30 % von ihnen müssen oft bis immer schmerzhafte bzw. ermüdende Körperhaltungen einnehmen, und 64 % führen oft bis immer repetitive Hand-Arm-Bewegungen durch. Außerdem zeigt unsere Studie, dass – neben der ergonomisch belastenden Arbeit mit manuellem Heben und Tragen schwerer Lasten – der Umgang mit Personen von den Mitarbeitern als relevantestes Merkmal der Tätigkeit gesehen wird (Abb.
1). Dieses Ergebnis lässt sich am ehesten dadurch erklären, dass die Entsorger in festen Kolonnen arbeiten und während der Fahrten zu den Abholorten – die einige Zeit in Anspruch nehmen – häufig mit anderen Verkehrsteilnehmern interagieren, vor Ort mit den Kunden Kontakt aufnehmen und miteinander in der Entsorgungsarbeit kommunizieren müssen.
Gemessen mit den von uns verwendeten COPSOQ-Subskalen zu quantitativen und emotionalen Anforderungen liegt die Belastung der Sperrmüllmitarbeiter mit den Werten von 44,7 ± 18,6 bzw. 41,8 ± 22,0 unter dem Durchschnitt, der in der Gutenberg-Gesundheitsstudie unter den Beschäftigten von Rheinland-Pfalz ermittelt wurde 49,34 ± 20,53 für die quantitative und 46,07 ± 21,80 für die emotionale Anforderung [
21].
Die in unserer Studie ermittelte Prävalenz von muskuloskeletalen Beschwerden ist höher als die der männlichen Bevölkerung. So liegt die 12-Monats-Prävalenz von Rückenschmerzen jeder Dauer und Stärke mit 70,4 % über der Prävalenz in der männlichen Bevölkerung in Deutschland mit 57,4 % [
19] bzw. 56,4 % [
28]. Dies ist auch der Fall, wenn nur die 12-Monats-Prävalenz der chronischen Rückenschmerzen betrachtet wird, d. h. von Schmerzen, die 3 oder mehr Monate anhalten. Die 12-Monats-Prävalenz der chronischen Rückenschmerzen liegt unter den Entsorgern bei 25 %, während in Deutschland diese für Männer je nach Quelle mit 17,1 % [
11] oder 19,7 % [
25] angegeben wird. Auch der Vergleich der Sperrmüllentsorger zu Männern mit niedrigem sozioökonomischem Status bzgl. Bildung, Einkommen und Beruf zeigt eine erhöhte Prävalenz von chronischen Rückenschmerzen in dem Kollektiv der Sperrmüllentsorger [
11]. Betrachtet man die Lebenszeitprävalenz chronischer Rückenschmerzen, ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei der Unterschied etwas weniger deutlich im Vergleich zu 12-Monats-Prävalenz ist: 29,6 % der Sperrmüllentsorger geben an, jemals im Leben Rückenschmerzen über 3 Monate oder länger gehabt zu haben; 27,6 %, also etwas weniger, der männlichen Bevölkerung in Deutschland geben dies an [
10]. Vergleicht man die Werte mit der Lebenszeitprävalenz bei Männern mit niedrigem sozioökonomischem Status bzgl. Bildung, Einkommen und Beruf, so sind kaum Unterschiede vorhanden [
10]. Tätigkeiten mit niedrigem Lohn bzw. Qualifizierungsanforderungen sind mit ergonomischen Belastungen assoziiert [
5].
Es ist davon auszugehen, dass die ergonomisch belastende Tätigkeit eine kausale Rolle für die Prävalenz der Rückenschmerzen spielt. Neben den von den Entsorgern angegebenen Arbeitsplatzbezug der Beschwerden, spricht für einen Zusammenhang, dass die Tätigkeit, wie oben beschrieben, ergonomisch belastend ist. In einer Felduntersuchung, die die Leitmerkmalmethoden für manuelle Arbeiten nutzte, konnte gezeigt werden, dass ein erheblicher Teil der in der Sperrmüllentsorgung durchgeführten Hebe- und Tragevorgänge im Bereich einer möglichen Überbeanspruchung realisiert werden [
22]. Die Tätigkeit geht zudem mit einer hohen körperlichen kardiovaskulären Beanspruchung einher, sodass eine Übermüdung begünstigt werden kann [
10].
Wie in der Literatur bereits beschrieben [
18,
28], gehen Rückenschmerzen mit erheblichen Einbußen in der Lebensqualität einher. Dies lässt sich in unserer Untersuchung auch für dieses berufliche Kollektiv bestätigen, wie die Ergebnisse in Tab.
7 unter Berücksichtigung des Alters zeigen. Gemessen mit der EuroQol-VAS finden wir schlechtere Werte als in einem Kollektiv von Straßenreinigern und in der klassischen Müllabholung [
26]. Mit 75,7 ± SD 13,3 liegt die Bewertung in der VAS in unserer Studie mit den Sperrmüllentsorgern auch unter den Werten aus repräsentativen Befragungen der deutschen Bevölkerung, welche mit 82 [
8] bzw. 79,2 ± 18 angegeben wird [
17]. Betrachtet man die Angabe des „besten Gesundheitszustands“ im EQ-5D (1-1-1-1-1), ist diese mit 20,3 % in unserem Kollektiv im Vergleich zu einer repräsentativen Befragung in Deutschland unterrepräsentiert [
7]. Ähnliches gilt, wenn der WHOQOL-Wert herangezogen wird, für den Normwerte anhand einer repräsentativen Befragung der Bevölkerung in Deutschland zur Verfügung stehen [
1]. Die Sperrmüllentsorger weisen hier mit 60,5 ± 21,9 (vs. 68,9 ± 17,4 der Bevölkerung; [
1]) für die globale Lebensqualität und 68,3 (SD 19,9; vs. 78,8 [SD 16,9]; [
1]) für die physische Lebensqualität deutlich niedrigere Werte auf, obwohl in der Normstudie der Bevölkerung auch ältere Personen und Personen mit chronischen Erkrankungen einbezogen wurden. Passend zu diesen Ergebnissen liegt die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands der Sperrmüllentsorger etwas schlechter als die der männlichen Bevölkerung in Deutschland [
12].
Zusammenfassend zeigt unsere Studie, dass die Tätigkeit in der Sperrmüllabholung mit einer hohen Prävalenz von muskuloskeletalen Beschwerden einhergeht. Das Auftreten von muskuloskeletalen Beschwerden ist mit einer verminderten Lebensqualität assoziiert. Unsere Studie zeigt zudem, dass die Tätigkeit mit erheblichen ergonomischen Belastungen verbunden ist. Beim Heben und Tragen entstehen Überbeanspruchungen nicht nur durch das Gewicht, sondern auch durch die Unhandlichkeit mancher Gegenstände, die die Einnahme von ungünstigen Körperhaltungen bei der Handhabung einfordern.
Bekanntlich spielen psychosoziale Faktoren wie Konflikte am Arbeitsplatz oder unbefriedigende Arbeit auch eine kausale Rolle in der Entwicklung körperlicher Beschwerden und insbesondere Rückenbeschwerden [
24]. Wie unsere Studie zeigt, ist der Umgang mit Personen, u. a. mit verärgerten Kunden oder Verkehrsteilnehmern, auch ein wichtiger Bestandteil der Entsorgertätigkeit und stellt möglicherweise eine relevante psychische Belastung mit der Folge des Auftretens körperlicher Beschwerden und einer Minderung der Lebensqualität dar.
Angesichts der erheblichen ergonomischen Belastungen, die bei der Ausübung der Tätigkeit vorliegen, besteht aus unserer Sicht Handlungsbedarf bzgl. der Gestaltung der Arbeit dieses Kollektivs. Interventionen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge und des betrieblichen Gesundheitsmanagements sollten ergänzend auch die psychosozialen Aspekte der Tätigkeit berücksichtigen.
Limitationen
Als Limitation unserer Studie ist das Querschnittstudiendesign zu nennen. Durch die gleichzeitige Abfrage der Outcomeparameter und möglicher erklärender Faktoren fehlt die zeitliche Dimension für Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Es erscheint in diesem Kollektiv plausibel, dass das Vorliegen muskuloskeletaler Beschwerden infolge der schweren Arbeit zu Beeinträchtigungen in der Lebensqualität führt, und nicht umgekehrt. Auch wenn die Befragung eine hohe Rücklaufquote von 53 % hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch vorwiegende Teilnahme derjenigen Personen mit muskuloskeletalen Beschwerden eine Überschätzung der Prävalenz von muskuloskeletalen Beschwerden in dem Kollektiv resultiert. Anhand der Merkmale, die uns für die Grundgesamtheit zur Verfügung gestanden haben (Alter, Ausbildungsstatus und Tätigkeit), lässt sich jedoch annehmen, dass die Antwortenden eine repräsentative Stichprobe des Kollektivs darstellen.
Die Erhebung erfolgte im Jahr 2018, was die Übertragbarkeit unserer Ergebnisse auf die jetzige Zeit potenziell einschränken könnte. Während des Corona-bedingten Lockdowns wurde die Abholung von Sperrmüll aus privaten Haushalten vorübergehend eingestellt. Nach Wiederaufnahme des Services wurden keine Änderungen in der Arbeitsabläufe bzw. Tourenorganisation eingeführt, sodass Unterschiede der Belastungssituation zwischen 2018 und heute nicht zu erwarten sind. Im Jahr 2019 erfolgten einmalige Kurse zu rückenschonendem Arbeiten in der Abteilung Sperrmüll. Die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit solcher Trainings ist gering [
27], sodass wir auch bzgl. der Beanspruchung davon ausgehen können, dass die jetzige Situation sich nicht wesentlich von der damaligen unterscheidet.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.